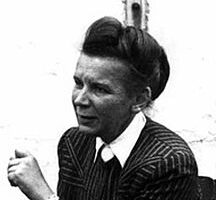Marie Juchacz (1879 – 1956)
Marie Juchacz spielte eine zentrale Rolle bei der Gründung der Arbeiterwohlfahrt. Sie wuchs in Landsberg an der Warthe auf. Nach der Volksschule arbeitete sie als Dienstmädchen, als Fabrikarbeiterin und als Krankenpflegerin. Schließlich konnte sie eine Ausbildung als Schneiderin machen. 1906 zog sie nach Berlin und trat in die SPD ein. Sie zeigte sich als gute Rednerin und wurde 1913 Frauensekretärin. Während des 1. Weltkriegs war sie in der Kriegsfürsorge tätig. Sie wurde zur Frauensekretärin des SPE-Vorstands berufen und wurde Schriftleiterin der Zeitschrift Gleichheit. Nach der Novemberrevolution wurde sie sozialdemokratische Abgeordnete und Mitglied des SPD-Vorstands. Sie forderte die Gründung einer eigenen Wohlfahrtsorganisation. Sie wurde die erste Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt und blieb dies bis zum Verbot der AWO 1933. Zuerst emigrierte sie ins Saarland, 1935 ging sie ins Elsass. Dort organisierte sie die Versorgung von Emigranten. Im Juli 1940 floh sie über Paris nach Marseille und konnte mit einem US-Notvisum im März 1941 Richtung New York aufbrechen. Sie blieb dort bis nach Kriegsende und organisierte mit der Arbeiterwohlfahrt New York Hilfspakete für den Wiederaufbau. Erst 1949 kehrte sie zurück nach Deutschland.
Lotte Lemke (1903 – 1988)
In Königsberg war Lotte Lemke in der Hauptwohlfahrtsstelle für Ostpreußen tätig. 1922 bekam sie von der AWO die Möglichkeit, ein Studium an der Hochschule für Politik in Berlin zu beginnen. Sie schloss als staatlich anerkannte Fürsorgerin ab und arbeitete in Brandenburg. 1929 wurde sie von Marie Juchacz in den Hauptausschuss der AWO nach Berlin geholt und wurde die erste Geschäftsführerin. Seit 1933 versuchte sie gegen die NSDAP zu wirken und involvierte sich in das Widerstandsnetzwerk der SPD. Seit 1942 arbeitete sie im Gesundheitsamt, bevor sie vor der Roten Armee nach Westen floh.
Dort übernahm sie 1946 die Geschäftsführung, erst Hannover dann ab 1952 Bonn. 1965 wurde sie dann zu Vorsitzenden der AWO gewählt und blieb dies bis 1971.
Helene Simon (1862 – 1947)
Obwohl eher traditionell bürgerlich aufgewachsen, nahm sie 1896 die Chance wahr, nach England zu gehen, um sich dort, wenn auch nur für ein Jahr, Soziologie zu studieren. 1897 wurde sie, gemeinsam mit Elisabeth Gnauck-Kühne, als Gasthörerin zu nationalökonomischen Vorlesungen bei Gustav Schmoller an der Universität Berlin zugelassen, konnte aber keinen formalen Abschluss machen und blieb im Grunde Autodidaktin und Privatgelehrte.
Um 1898 untersuchte sie im westfälischen Schwelm, wohin ihre Schwester Elise Meyer geheiratet hatte, Missstände der dortigen Textilwirtschaft. Sie machte auf den Arbeitseinsatz von Frauen und Kindern, überlange Arbeitszeiten und mangelnde Gesundheitsvorsorge im Artikel „Die Bandwirker in und um Schwelm“ aufmerksam (Zeitschrift „Soziale Praxis“, Jahrgang 8, 1898/1899). Zwischen 1919 und 1923 lebte sie noch einmal im Haus der Bankiersfamilie Meyer in Schwelm.[2]
In den Jahren bis 1914 veröffentlichte sie eine Großzahl von Zeitschriftenbeiträgen über soziale Fragen, die in SPD- und Gewerkschaftszeitschriften wie Die Gleichheit und Die neue Zeit erschienen, sowie mehrere Bücher und Buchbeiträge. Sie übersetzte grundlegende Beiträge englischer Sozialpolitiker ins Deutsche. 1905 veröffentlichte Simon die erste deutschsprachige Biographie über den britischen Sozialrefermer Robert Owen. Das Buch war das Ergebnis ihrer Arbeit in England und gilt bis heute als Standardwerk über Owen. Sie veröffentlichte weitere Biografien zu William Godwin, Mary Wollstonecraft, Elisabeth Gnauck-Kühne und Albert Levy. 1904 hielt sie ein Referat auf dem Internationalen Frauenkongress in Berlin über Arbeiterinnenschutzgesetze. 1911 war sie Ausschussmitglied in der Gesellschaft für soziale Reform.
Während des Ersten Weltkriegs wurde sie hauptamtliches Mitglied im geschäftsführenden Arbeitsausschuss der „Kriegshinterbliebenen- und -beschädigten-Fürsorge“, die einzige Zeit, in der sie angestellt war. Seit Januar 1917 war sie Mitherausgeberin der Zeitschrift Soziale Kriegshinterbliebenenfürsorge.
Nach dem ersten Weltkrieg wurde sie Mitglied der SPD und arbeitete wieder freiberuflich als Autorin. Sie wirkte maßgeblich am Aufbau der von Marie Juchacz 1919 gegründeten Arbeiterwohlfahrt und ihrer Wohlfahrtsschule mit. 1922 wurde sie als Ehrendoktorin der Universität Heidelberg geehrt. Ihre letzten Veröffentlichungen erfolgten 1932. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 blieb sie, zur Sprachlosigkeit verurteilt, noch bis 1938 in Deutschland, bis sie sich nach der Reichspogromnacht gezwungen sah, mit ihrer Schwester Klara Reichmann nach England zu emigrieren.
Clemens Högg (1880 – 1945)
Schon im Kaiserreich war er Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Nach der Revolution wurde er 1919 Bürgermeister von Neu-Ulm. 1922 initiierte er die Gründung von Ortsausschüssen der Arbeiterwohlfahrt in Neu-Ulm und Augsburg. 1924 wurde er Abgeordneter des bayerischen Landtags und SPD-Parteisekretär. 1933 wurde er verhaftet und bis Oktober 1934 im KZ Dachau eingesperrt, 1939 wurde er zum zweiten Mal verhaftet, weil er Verbindungen zu einer Widerstandsgruppe hatte, und ins KZ Sachsenhausen gebracht. Dort wurde er gefoltert, wodurch er erblindete und ein Bein verlor. Anfang 1945 wurde er ins KZ Bergen-Belsen transportiert und starb dort im März 1945.
Johanna Kirchner (1889 – 1944)
Johanna Kirchner war Kommunalpolitikerin in Frankfurt am Main, ihr Schwerpunkt war das Engagement für Kinder in Not. Nach 1933 floh sie ins Saarland. Sie unterstützte mit Marie Juchacz zusammen Emigranten und den sozialdemokratischen Widerstand. 1935 musste sie weiterflüchten nach Lothringen und wird 1940 vom französischen Vichyregime inhaftiert und ins Lager Gurs deportiert. Nach ihrer Flucht tauchte sie unter. 1942 wurde sie zum zweiten Mal verhaftet und in Berlin und Cottbus eingesperrt. Der Volksgerichtshof verurteilte sie im Mai 1943 zu zehn Jahren Haft. Am 20. April 1944 wurde das Urteil auf Betreiben des Volksgerichtshofvorsitzenden Freisler, der ihr vorwarf, „jahrelang unter Emigranten und in unserem Reich hochverräterisch gewühlt” zu haben, in die Todesstrafe umgewandelt. Sie wurde wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee am 9. Juni 1944 hingerichtet.